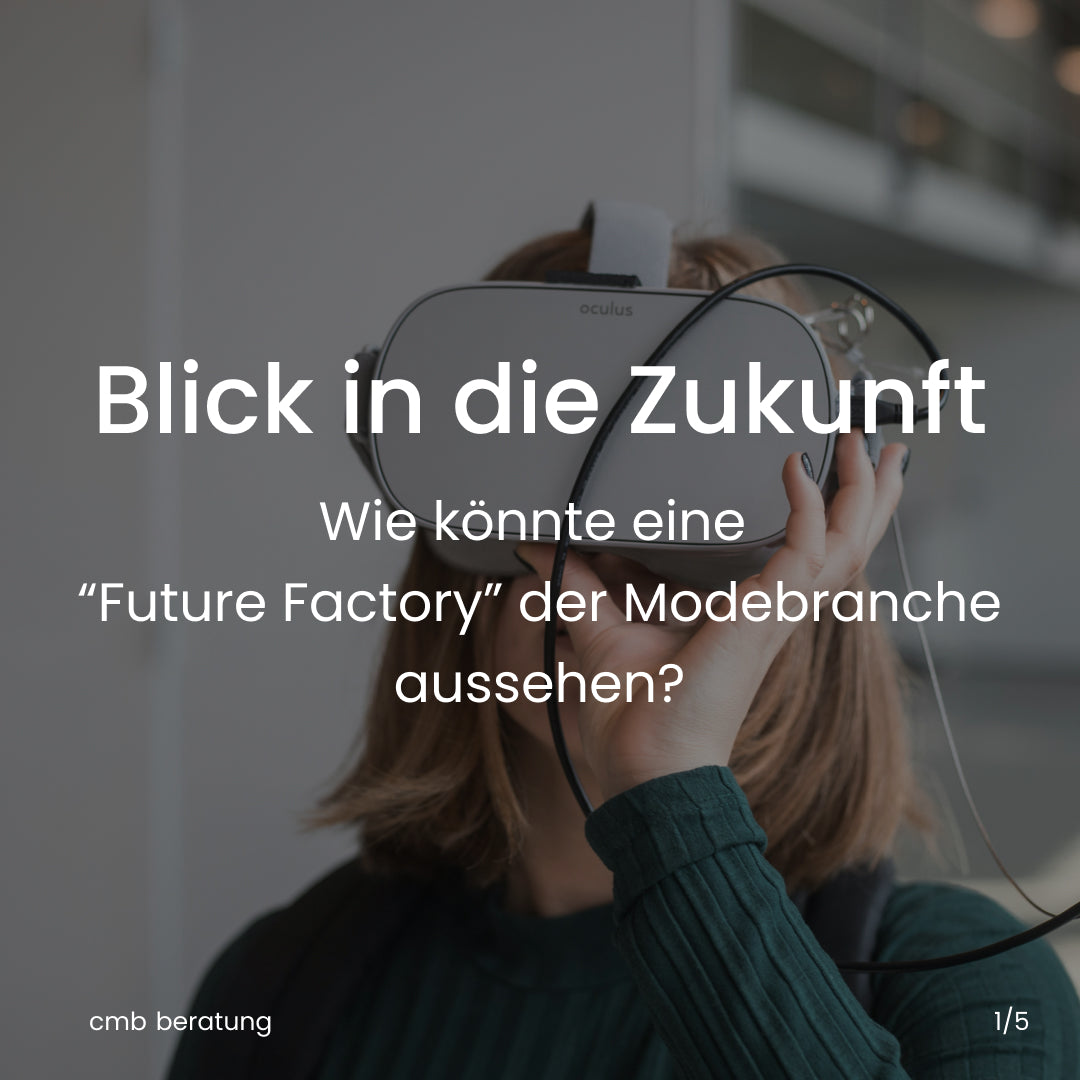Oft sprechen wir über das, was in der Modeindustrie nicht funktioniert – über Ausbeutung, Überproduktion, Umweltbelastung. Aber wie könnte es besser gehen? Was wäre, wenn wir die Prozesse neu denken würden – radikal, nicht nur in kleinen Schritten? Die Idee einer „Future Factory“ liefert eine mögliche Antwort.
Was wäre, wenn…
Was wäre, wenn Kleidung nicht mehr in Massen vorproduziert, sondern auf Bestellung gefertigt würde – maßgeschneidert, lokal und ohne Ausbeutung? In einer solchen Vision scannt sich der Kunde zu Hause per Smartphone, die Maße gehen direkt in ein System, das das Wunschprodukt virtuell visualisiert.
Anschließend startet automatisiert die Produktion – regional, in einer Fabrik, in der Roboterarme alle Schritte verbinden: Zuschnitt, Zusammennähen, Veredeln. Das Kleidungsstück entsteht in wenigen Minuten an einem Ort. Kein Transport über Kontinente. Keine langen Lieferketten.
Fortschritt ohne Menschenverachtung
Diese „Fabrik der Zukunft“ arbeitet nicht mit billiger Arbeitskraft, sondern mit Technologie. Mechanische Systeme übernehmen die Arbeit, Menschen überwachen den Prozess. Sobald das Kleidungsstück fertig ist, wird es automatisiert verpackt und klimafreundlich per Fahrrad oder E-Auto geliefert.
Recycling als Teil des Konzepts
Denkbar ist auch: KI-gestütztes Recycling. Kleidung wird so aufbereitet, dass sie wiederverwendet werden kann – regional, automatisiert, im Kreislauf. Weniger Müll, mehr Ressourcenverantwortung.
Warum das heute noch nicht Realität ist
Die Technik wäre da. Was fehlt, ist die Bereitschaft, alte Denkweisen loszulassen. Statt auf Innovation hat sich die Branche zu lange auf Verlagerung konzentriert. Doch wer Fortschritt will, muss zuerst die bestehenden Strukturen hinterfragen – und sich von ihnen lösen.